Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Brüder Alexander und Jakob sowie deren österreichische Familie mit rechts-konservativem Einschlag. In einigen Partien taucht auch ihre Schwester Luisa wieder in heimischen Gefilden auf – das dritte Kind im Bunde, dem die Abnabelung von der Familie mit einem zwischenzeitlichen Aufenthalt in Schweden bei Ehemann und Kind ebenso wenig gelingt wie später Jakob, dem jüngeren der beiden Brüder, der am Ende des Romans wieder bei seinen Eltern einzieht.
Thema des Romans ist somit das Erwachsenwerden und die Schwierigkeiten, außerhalb der gesicherten Grenzen der Familie auf eigenen Beinen zu stehen. In diesem Fall eine Familie, die in eine enge, miefige Welt gezeichnet wird, die unter einen mentalem Lockdown zu leiden scheint.
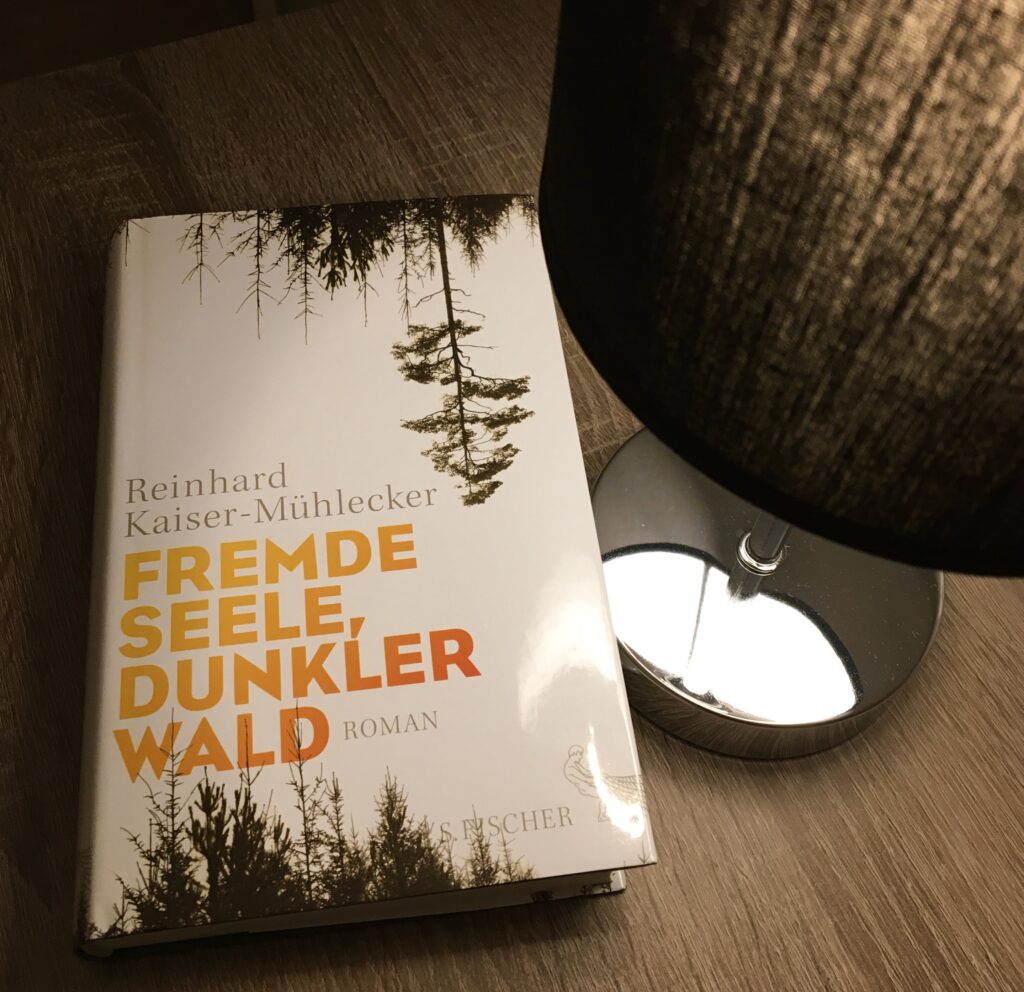
Schon bei Charaktereinführung fällt auf: Alexander und Jakob folgen nicht im Ansatz einer traditionellen, vorgezeichneten Bahn mit der Abfolge von „verliebt – verlobt – verheiratet“, wie es ihnen im Dreigenerationenhaus, in dem sie aufwuchsen, vorgelebt wird. Alexander ist vielmehr ein Frauenheld und achtet streng darauf, niemals von einer seiner Affären auch nur andeutungsweise auf eine Bindung festgenagelt zu werden. Bei Jakob deutet sich mit der Figur des Markus‘ über weite Strecken der Handlung ein homosexuelles Motiv an, bis Markus sich schließlich erhängt. Zum Zeitpunkt seines Selbstmordes war Jakob mit Nina verheiratet, die ihm eigentlich vollkommen zuwider ist. Nur eines gemeinsamen Kindes wegen willigte er in die Heirat ein – bis sich herausstellte, dass das Kind gar nicht von ihm ist. Er verlässt sie.
Alexander findet am Ende seine große Liebe und erweist sich auf einmal dann doch als bindungsfähig. Für Jakob, der beständig Reißaus nehmen möchte, aber nicht vorwärtskommt und schließlich wieder bei seinen Eltern einzieht, deutet sich am Ende derselbe Weg wie bei Alexander an: Er möchte zum Mililtär. Ob das aber das Richtige für ihn, den „zarten Jungen“ (S. 301), sein wird, beantwortet der Roman nicht mehr.
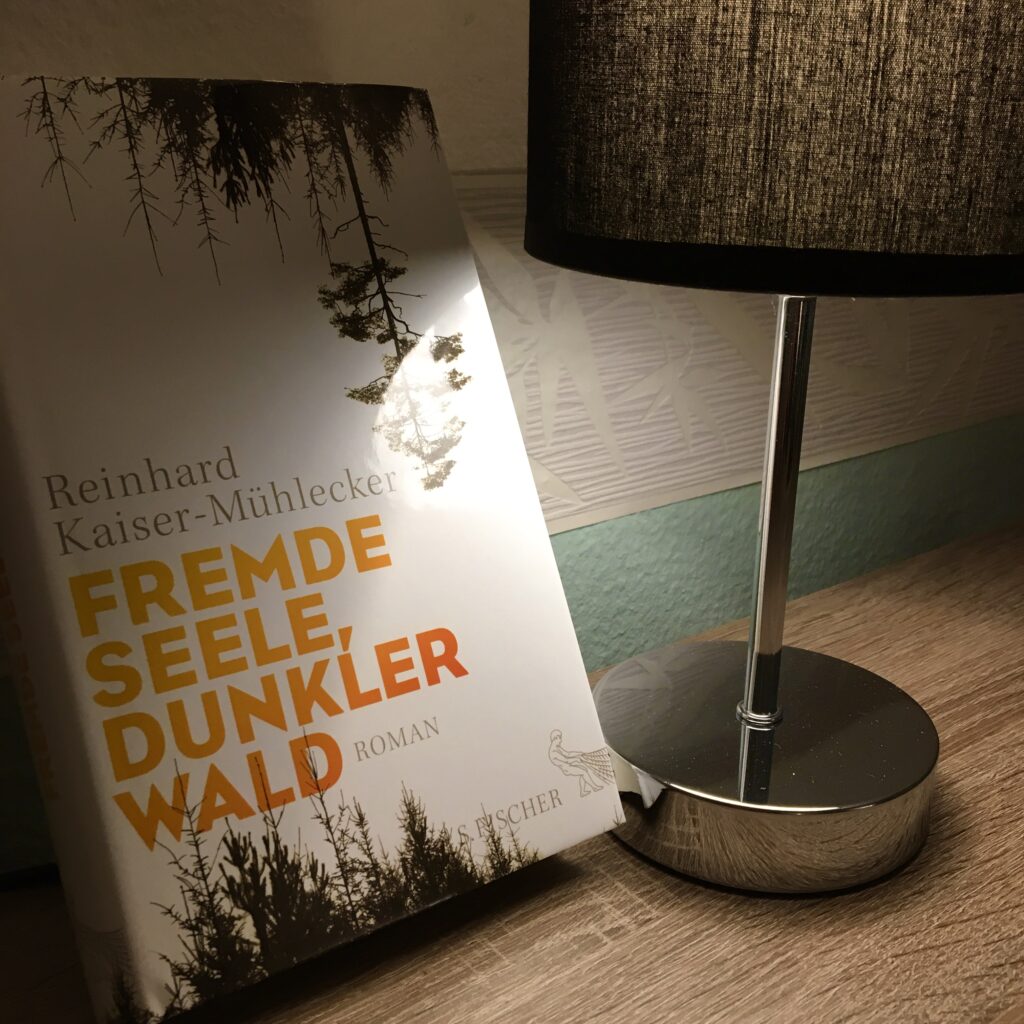
Das traute Heim, der Wunsch nach einem Zuhause und einer Ankunft im Leben wird in diesem Brüderroman metaphysisch überhöht und bildet lange Zeit einen unerreichbaren Fluchtpunkt – zumindest aus der Perspektive der Brüder. „Als wäre es zu Hause“ (S. 265), geht es Alexander einmal durch den Kopf, als er während einer Reise beim Sightseeing in einer Kirche Platz nimmt. Alexander, der schon früh die Familie verließ, war einst Stiftszögling und hatte eine Priesterlaufbahn erwogen, ehe es ihn zum Militär zog bzw. zu Beginn des Romans zu einem Auslandseinsatz.
Nicht nur mit dem religiösen Konnex deutet sich immer wieder Metaphysisches an. Auch angedeutete Naturschilderungen, die die Landschaft in einen zeitlosen Raum rücken bzw. das Vergehen von Zeit kaum mehr wahrnehmen lassen (wann fiel bereits Schnee oder noch nicht oder wann war er schon längst wieder geschmolzen?), verwischen Wirklichkeit. Darauf zahlen auch immer wiederkehrende Formulierungen wie „keine neuen Geschichten mehr“ (S. 177) ein, die einen immergleichen Ablauf des Lebens evozieren. Einen schönen Auftakt dazu gibt ein Birkenblatt am Anfang des Romans, das sogar bis auf die Färbung genauso aussieht, wie ein zuvor herbeigewehtes Birkenblatt – und wohl auch für die selbe Situation der Brüder einsteht.
Die Geschichte in „Fremde Seele, dunkler Wald“ spielt zu der Zeit, als die Russen die Krim besetzen – und ebenso, wie in der Ukraine die Grenzen verwischen, verläuft sich scheinbar auch das Leben der Söhne im Ungefähren, im Heimatlosen, und sie haben Schwierigkeiten, ihrem Leben Kontur zu verleihen. Die Möglichkeit, wieder zuhause einzuziehen und sich dadurch auf allzuleichte Weise seiner eigenen Grenzen zu versichern, erweist sich vor allem im Falle Jakobs als Trugschluss.
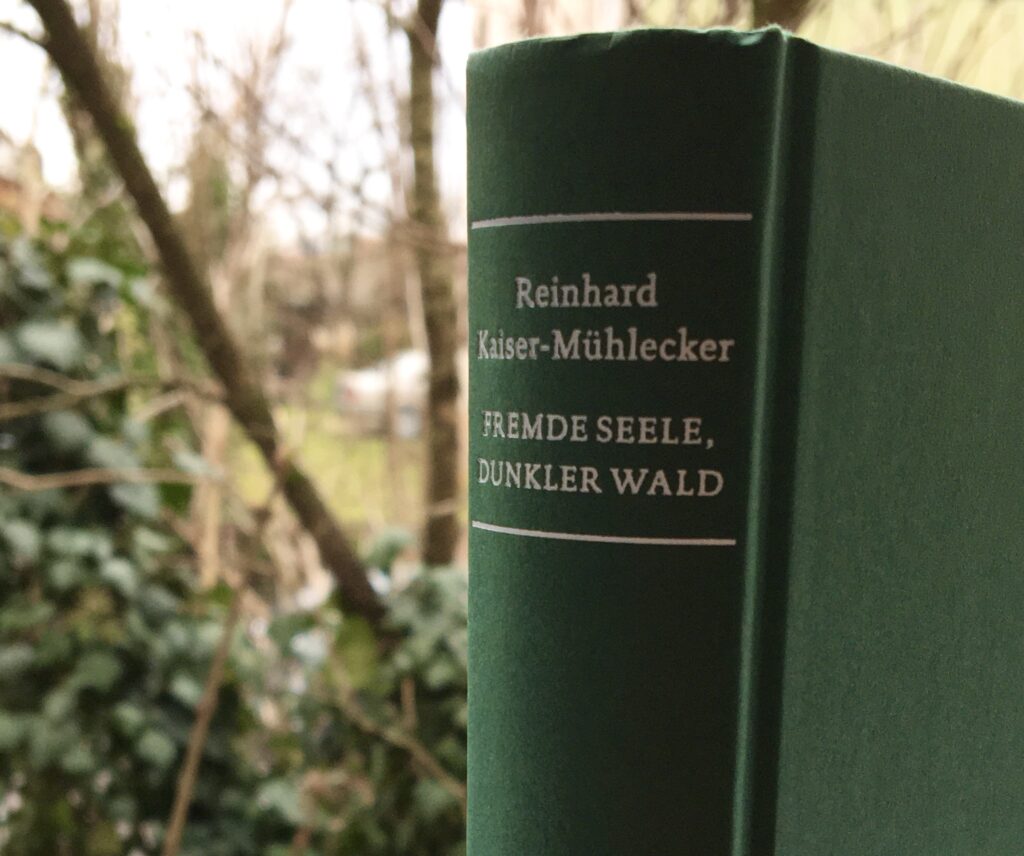
Fast der gesamte Erzähltext ist als ineinander verschränkte Parallelhandlung der beiden Brüder Alexander und Jakob angelegt – mit recht kurzen, rasch wechselnden Kapiteln. Das sorgt für die starke Sogwirkung der Geschichte, ist aber auch durchschaubar. Ebenso wie die Hintergrundgeschichte um das Erpresserpärchen Elvira und Erwin Hager und einen mysteriösen Mordfall im Nachbardorf bildet dieses Erzählmuster Strategien aus der Spannungsliteratur nach, die mehr und mehr zum Fundus oder sogar zum guten Ton in der deutschen Literatur zu gehören scheinen.
Diesem wohl zeitgemäßen Ansatz steht im Fall von „Fremde Seele, dunkler Wald“ ein Tonfall gegenüber, der immer wieder an einen klassische Erzähler denken lässt – der metaphysische Raum der Naturzeichnung kommt somit nicht nicht von ungefähr und findet auch tatsächlich im Erzählgestus seinen Niederschlag.
Während die unzähligen Fragesätze in der Figurenrede dem Gefühl der völligen Verunsicherung und Orientierungslosigkeit der Hauptpersonen Ausdruck verleihen und lediglich mit einer auktorialen Erzählerstimme spielen, geben Sätze wie „Die Wochen vergingen in der gewohnten Weise“ (S. 102), „Die Reise begann sich schnell als abwechslungsreich und sogar sehr unterhaltsam herauszustellen“ (S. 132) oder einfach: „Drei Tage vergingen so“ (S. 144) den changierende Charakter auf und imitieren unverblümt klassisches Erzählverhalten. Die gelegentlichen umständlichen Satzkonstruktionen werden dabei nur allzu gern gewürzt durch das auratische und ekphratische Partizip Präsenz: „Er bückte sich und schaute unter den Tisch, bevor er sich wieder aufrichtete und die Zeitung an die Theke zurückbrachte, sich verabschiedete und ging, ein Bein etwas höher als das andere hebend.“ (S. 12.)

Am Ende ist es jedoch ein trotz allem frischer Erzählton mit viel Sogwirkung, der eine schnelle Lektüre ermöglicht. Denn es ist gerade die moderne Kontingenz der Lebensentwürfe, von der der Roman erzählt, und eben die hohe Dichte an schnell aufeinanderfolgenden Szenen, von denen gelegentlich aber fraglich bleibt, ob sie in jedem Einzelfall für die Handlung nötig gewesen wären. Ebenso scheinen manche Episoden schief geraten und die Figuren bleiben allzu schemenhaft. Darunter leidet der Erzähltext etwas, der allerdings – wie die Widmung des Autors schon sagt – eine lupenreine Geschichte ist.
Dies, das Nacherzählen eines Plots, was man sich klassischerweise in einer Familie an langen Abenden vorstellen kann, steht für den Roman denn auch im Vordergrund: Er ist nicht Avantgarde, er thematisiert nicht Sprache, ist nicht artifiziell und findet nicht in Stilübungen seinen Schlussstein. Sehr stark sind dabei die Auslassungen, mit denen Reinhard Kaiser-Mühlecker im gesamten Roman versiert arbeitet und ein Stückchen gelungener Erzählkunst vorführt.
